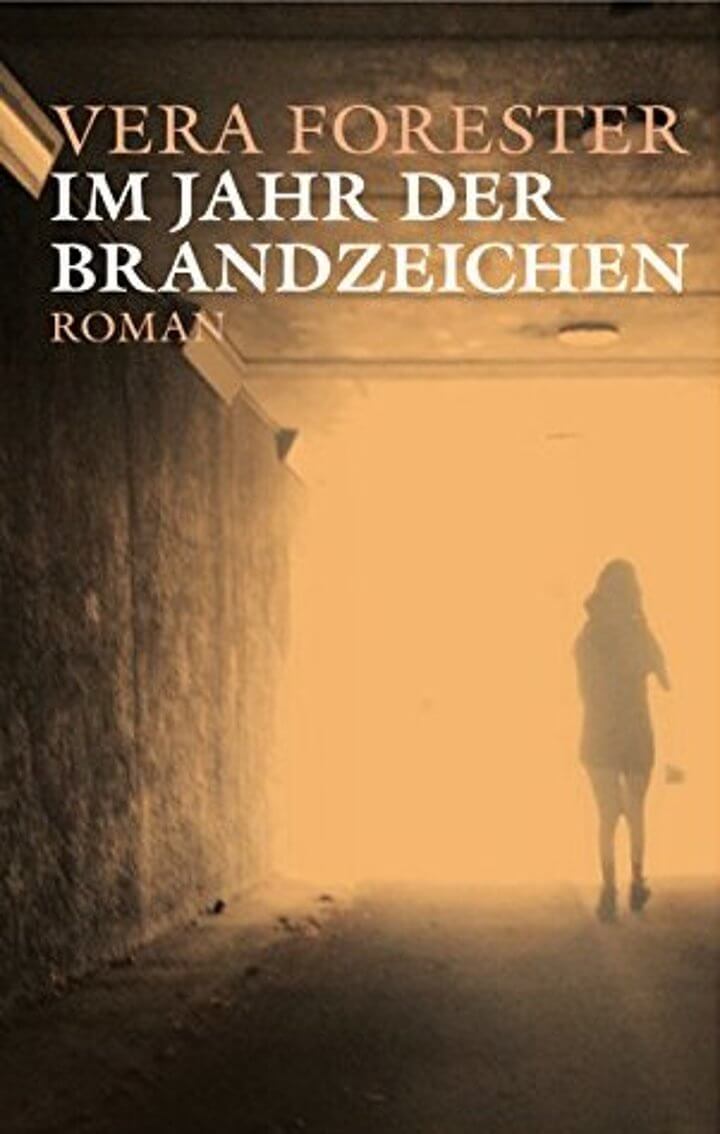Nur nicht bei einem Unfall ums Leben kommen: Der Tod durch einen Flugzeugsabsturz, ein Schiffsunglück oder einen Tsunami kränkt unsere Eitelkeit. Gott, so glauben (und wünschen es sich) viele, ist der, der uns als Individuen seinen Lebensodem einhaucht und uns auch als Individuen wieder abberuft, vielleicht sogar genau so, wie wir es verdient haben … Und dabei gäbe es kein Vertun, oder?!
Gott hat sich vertan. Diesen ungeheuerlichen Verdacht hegt in den Dialogen der Karmelitinnen, der 1957 in Mailand uraufgeführten Bekenntnisoper von Francis Poulenc, Schwester Constance, nachdem sie die Priorin des Ordens, Madame de Croissy – ein gestrenges Bollwerk des Glaubens wider den Atheismus der Französischen Revolution – auf dem Totenbett elendig ersticken sah, allen Gottvertrauens und aller Glaubenszuversicht beraubt, überzogen mit einer „wächsernen Maske“ aus namenloser Angst. Stirbt so die Erste ihres Ordens?
„Gott“, so mutmaßt Schwester Constance, „vergriff sich vielleicht in der Todesart, als er diesen Tod geschickt, so wie man Kleider auf der Kammer verwechselt. Ja, die Mutter“, folgert sie weiter, „starb den Tod einer anderen.“ – Aber wessen Tod? Schlummert nun unerkannt eine Heldin in den Reihen der Karmelitinnen, eine, die ihre eigene verzweifelte Todesangst der Priorin vermachte und die nun, als Folge des „Fehlgriffs in der Kleiderkammer“, dem eigenen Ende mit mutiger Todesverachtung entgegentreten wird?
Es gibt sie: Schwester Blanche von der Todesangst Christi. Ein junges Mädchen, dessen Ur-Angst schon in den Umständen seiner Geburt begründet liegt. Starb doch die Mutter, die Marquise de la Force, bei ihrer Geburt, nachdem unmittelbar zuvor deren vornehme Karosse vom in Panik geratenen Pöbel an der Weiterfahrt gehindert worden war. Blanches Angst ist die Angst vor dem Leben, die Angst vor dem Tod und die Angst vor einer Zeit, in der der Kopf des Königs nicht mehr wert sein wird als der Kopf eines Tollwütigen in einer Anstalt, der auf seine Hinrichtung wartet …
Blanche: Vater und Bruder versuchten, ihr den Eintritt in Kloster auszureden, die Priorin schien sie mit harten Worten abzuschrecken, aber in diesem Verbund von Gleichgesinnten – Frauen, die außerhalb der Welt und außerhalb jeder Bevormundung durch Männer leben – reift in ihr eine Kraft heran, die sie zu guter Letzt zu einer einzigartigen Tat befähigen wird: Nach der Zerschlagung des Ordens, der Verhaftung fast aller Nonnen (bis auf Blanche und Mère Marie) und der Verkündung des Todesurteils kehrt sie, während der Hinrichtungs-Prozedur, aus freien Stücken in die Gemeinschaft der Todgeweihten zurück und liefert sich als Letzte dem Fallbeil aus.
Musikalisch hat Francis Poulenc (1899 - 1963) die Partitur ausdrücklich vier Komponisten-Vorgängern gewidmet: Debussy, Monteverdi, Verdi und Mussorgsky. Verdi zollt er Respekt (wider Wagner) mit dem steten Vorrang der Stimme(n) vor dem Orchesterklang, Monteverdi und Debussy stehen Pate für einen zwischen rezitativischem und ariosem Stil sich fließend an die französischen Sprache anschmiegenden Wort-Ton-Duktus, während Mussorgskys Vorbild unmittelbar in der orchestralen Glockenimitatorik anklingt.
Dem Bekenntnis zur Tradition in den Mitteln entspricht das Bekenntnis zur Tradition im Inhaltlichen: Nach den Barbarei des Zweiten Weltkriegs und den Gräueln des Holocaust darf das „Credo“ der Karmelitinnen auch vor der konkreten historischen Folie der Französischen Revolution als ein „epocheübergreifender Garant für ein verbindliches Wertesystem“ (Robert Maschka) verstanden werden.
Dieses Wertesystem wird aber nicht verordnet, sondern entsteht aus den Glauben und Zweifel gleichermaßen widerspiegelnden „Gesprächen“ der Karmelitinnen: Christus gibt ihrer Suche den Inhalt, die (Dialog-)Form hingegen geht auf Sokrates zurück. Und die ketzerische Frage, ob Gott gar ein Totenkleid „verwechseln“ konnte – das Bild, in dem das Verhältnis der alten Priorin (Madame de Croissy) zu ihrer letzten Novizin (Blanche) so wunderbar gefasst wird – ist nicht frei von einem aufklärerischen Lächeln.
(Quelle: Theatermagazin März 2012 von
Wolfgang Haendeler)
Libretto vom Komponisten
nach dem zum Drama umgearbeiteten
Drehbuch von George Bernanos
auf die Novelle Die Letzte am Schafott
von Getrud von le Fort
In französischer Sprache
mit deutschen Übertiteln
Musikalische Leitung Dante Anzolini / Marc Reibel
Inszenierung Roland Schwab
Bühne David Hohmann
Kostüme Gabriele Rupprecht
Chorleitung Georg Leopold
Dramaturgie Wolfgang Haendeler
Blanche Myung Joo Lee
Marquis de la Force Seho Chang
Der Kerkermeister Franz Binder
Chevalier de la Force Jacques le Roux, Pedro Velázquez Díaz
Madame de Croissy Karen Robertson
Madame Lidoine Cheryl Lichter
Mère Marie de
l’Incarnation Larissa Schmidt
Sœur Constance
de Saint-Denis Elisabeth Breuer
Mère Jeanne Kathryn Handsaker
Sœur Mathilde Martha Hirschmann / Vaida Raginskyte
Der Beichtvater Matthäus Schmidlechner
1. Kommissar Hans-Günther Müller
2. Kommissar Leopold Köppl
Thierry Marius Mocan / Andrzej Ulicz
Javelinot und 1. Offizier Ville Lignell
Chor und Extrachor des Landestheaters Linz
Bruckner Orchester Linz
Weitere Termine 27. und 30. März; 13. und 19. April 2012